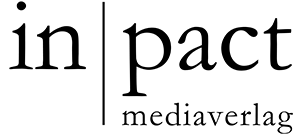Spätestens wenn ein bekanntes schwedisches Einrichtungshaus Lampen, Dimmer oder Bewegungsmelder anbietet, die per App gesteuert werden können und diese Kollektion sogar einen eigenen Namen hat, steht fest: Smart Living ist keine Spielerei mehr für irgendwelche Tech-Nerds, es ist in der breiten Bevölkerung angekommen. Das belegen auch diverse Studien, die für das Jahr 2021 – je nach Abgrenzung – von einem weltweiten Marktvolumen von 19 bis 30 Milliarden Euro ausgehen. Laut Statista lag der Umsatz mit Smart Living in Deutschland bereits bei 1,29 Milliarden Euro. Bis 2021 soll das Volumen auf 4,14 Milliarden ansteigen – eine Steigerung von über 30 Prozent. Kein Wunder, dass hier jeder einen Teil des Kuchens abhaben möchte und das Bundeswirtschaftsministerium mit der „Wirtschaftsinitiative Smart Living“ die Aktivitäten „made in Germany“ weiter vorantreiben will. Man müsse die Innovationsdynamik bei Smart-Living-Technologien steigern, wenn Deutschland vorne mit dabei sein wolle, heißt es.
Zunächst aber gilt es, die Verbraucher zu überzeugen, die eigenen vier Wände voll zu digitalisieren. Das hat die Geschichte des Smartphones gezeigt: Denn obwohl IBM als erster Anbieter mit einem Smartphone auf dem Markt war, kam der große Durchbruch doch erst mit dem iPhone – Apple-Design, Usability und sicher auch dem Markennamen sei Dank. Solange Kunden also im Elektronikmarkt vor einer riesigen Wand mit Smart-Home-Produkten stehen, jedoch aufgrund verschiedener Standards nicht wissen, welche Lösung mit bereits vorhandenen Produkten kompatibel ist, ist die Hemmschwelle eindeutig zu groß. Offenheit ist demnach das oberste Gebot neuer Technologien.
Ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie die IFA Berlin im September letzten Jahres gezeigt hat: Arbeitsplatten in der Küche, die abgestellte Speisen automatisch kühlen oder aufwärmen. Persönliche Kalender, die der Heizung mitteilen, ab wann jemand im Haus ist und es kuschelig warm sein sollte. Oder eine Schnittstelle im Auto, die dem Garagentor ankündigt, dass es in etwa fünf Minuten geöffnet sein sollte. Ja sogar Kühlschränke, die dank künstlicher Intelligenz Einkaufslisten schreiben, sind keine Fiktion mehr.
Smart-Home-Lösungen können aber noch viel mehr – gerade mit Blick auf den demografischen Wandel unserer Gesellschaft. Sensoren im Boden könnten Stürze oder Unfälle im Haus melden oder über Alexa und Co. direkt einen Notruf absetzen. Damit geht es nicht mehr nur um den eigenen Komfort, sondern auch um Sicherheit und Ressourcen. Wobei die Sicherheit der Anwendungen selbst oftmals scharf in der Kritik steht. Denn sämtliche Smart-Home-Lösungen sammeln natürlich jede Menge Daten über die Bewohner. Und da die Anwendungen in der Regel online sind, ist die Gefahr groß, dass sich Hacker Zugriff verschaffen, Daten abgreifen, einbrechen oder das Zuhause in anderer Weise manipulieren. Hier müssen die Anbieter erst noch überzeugen. Wobei das Siegel „made in Germany“ gerade mit Blick auf die Sicherheit sowie mit deutschen Rechenzentren punkten könnte.

Illustration: Sophie Mildner